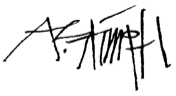"August Stimpfl - Das Erkunden des Weiblichen"
{{Was von August Stimpfls Arbeiten zu erkennen ist, reicht ganz wesentlich über das hinaus, was zunächst die Augen beschäftigt. Es ist nicht nur die Figur sondern in erster Linie das, was von außen in sie hineinfließt und von ihr wieder zurückkehrt, eine Bewegung also, die sowohl statische wie auflösende Momente in eins zusammenführt, ein beziehungsreiches, auch antagonistisches Geflecht, durchströmt von Freude, Bitternis, Erkenntnis, von Martyrien und Erlösungen, von Aufgewühltheit und Beruhigung, von Skelett und Fleisch, von Traum und Wirklichkeit; durchpulst von nervösen Zuckungen, die das eine verbergen und das andere betonen, Auseinanderstrebendes wieder zusammenfügen, Teilungen festigen, Vergitterungen auflösen, kompakt Körperliches offen halten und sich blütenartig entfalten lassen, wobei das Absterben, das Verdorren des Blühenden sich in ihm schon eingeschrieben zeigt. Von der Form her zeigen sich Stimpfl’s Figuren meist als frontale, achsiale, ausbalancierte, archaische Körper; aber das ist nur ihre Anlage, ihr Umriss, nicht die Landschaft, die er aus diesen Formen entwickelt -eine Landschaft voller Sinnlichkeit, aber auch Seele, ein durchlässiges Gewebe für Empfindungen, ein wohlakzentuiertes Sichkreuzen von verwischten Linien, die das Spröde mit dem Eleganten verbinden und aus deren Feld sich herauslöst, was Frauen wie Pflanzen, wie ein Empfangen und Verschlingen, aber auch wie ein Heraustreten und Zuneigen erscheinen lässt. Was Stimpfl mit Kohle zeichnet oder was er einem malerisch verfeinerten Zusammenspiel von dämmernden Farben: Ocker und Umbra, Indischrot, Kobalt und Paynesgrau zuordnet, trennt nichts voneinander und fügt auch nichts zusammen, was im Menschen nicht angelegt wäre: Das Zarte, Feine, Anziehende, Verführerische und das Harte, Aggressive, Ausbrechende; Lyrisches und Expressives; den Traum von Freiheit und den Sturz: Stimpfl deutet, was er meint, auch in den Bildbezeichnungen an, nur ist in seine "Freiheit" auch einbezogen, was sie aufhält, solange sie sich im Körperlichen bewegt - es sind zugleich die Grenzen der Kunst. Entschieden, sicher und mit einem ausgeprägten plastischen Empfinden bei aller graphisch-malerischen Grundstimmung fügt Stimpfl an- und ineinander, wovon auch Raum und Atmosphäre, das erotische Fluidum seiner Körper bestimmt werden. Seine eigentliche Leistung besteht darin, wie er eben auch Körperliches als Werdendes erleben lässt, indem er alles nur so weit festlegt und präzisiert, dass daraus für den Betrachter keine Fessel wird, im Gegenteil: dass er sich sowohl hier wie dort aufhalten und eindenken, einfühlen kann, ohne mit einer anderen Gewissheit entlassen zu werden als der: da hat es einer geschafft, quer durch alle in diesem Jahrhundert bereits durchexerzierten Methoden seinen eigenen Ausdruck aus dem Zusammenführen der verschiedenen Komponenten zu finden und darüber hinaus ohne jede Peinlichkeit ästhetisch zu wirken, einfach deswegen, weil nicht kalkuliert ist, was er macht, sondern spürbar erlebt und nicht ohne Plage niedergeschrieben. Natürlich handelt es sich dabei um die Teile eines einzigen großen Bildes, an dem Stimpfl arbeitet; aus der Zusammenschau der Teile kann man ihm unschwer näherkommen, ohne es je ganz fassen zu können, weil es sich auch ihm immer wieder entzieht. Das Anziehende an Stimpfl’s Erkundigung der weiblichen Psyche, dessen, was über das Fest der Leiblichkeit hinausreicht, ist die Art, wie er das "Schöne" mit dem "Hässlichen" zu verbinden und in eine Zone zu verwandeln versteht, aus der jenes einheitliche Gefüge hervortritt, dem man im Bereich zeitgenössischer Kunstproduktion in dieser Verdichtung nicht allzu häufig begegnet. }}
Eine Form des Staunens
{{Dort, wo er herkommt, wohin er wieder zurückgekehrt ist, wo er sitzt und beobachtet, denkt, arbeitet, herumgeht, sein Werk entwickelt, eigen und doch über viele Adern verbunden mit dem, was auch andere berührt und antreibt in einer Art passiv-aktiven Reagierens — dort, sagt man, sei die „Provinz". Mit ihren Anforderungen für den, der ihr geistig nicht angehört und der doch auch ihren Versuchungen ausgesetzt ist. In Ruhe gelassen sozusagen — aber ist das möglich im Zeitalter überall gegenwärtiger „Information", die abseits der „Zentren" womöglich aufmerksamer aufgenommen wird, analysiert, in ein „Weltbild" eingebaut wird, dann aber auch relativiert? Abgeschottet und doch mitten drin, gleichzeitig aber auch ganz woanders, wohin die Sinne ziehen und das Wurzelwerk inmitten eines großen alpinen Talraumes mit seiner alten Geschichte. Und noch immer ist ihm alles in Erinnerung, noch immer beschäftigt ihn das, noch immer ist es ihm gegenwärtig, lenkt auch den Prozess seiner Bild(er)findungen: der Krieg, das Verbrechen (neuerdings Cortez: Was ist mit Menschen passiert?), das Aufwachsen mit Handwerken, der verfolgte Vater, der Akademiebetrieb in Wien, Reiseeindrücke. Vor allem aber: was in ihm ist, was sich in ihm abgelagert, aber auch geklärt hat, will austreten aus der umgrenzten, der begrenzten Fläche des Bildes. Es öffnet sich, reißt Raum auf, transformiert, lässt in die Tiefe fallen und tritt aus ihr wieder herauf, schwillt zu Körper-Gebirgen an. Verborgenes wird geborgen, ausgestülpt. Leben blüht auf und verdorrt. Das Werdende und das Vergehende sind eins. Verwundung und Geheiltes. La Belle et la Bete. Das geht weit zurück und ist doch ganz gegenwärtig. Schwer und leicht, nervös und zerrissen, entschlossen und tastend fügen sich das Aufgelöste und Zusammengeholte, das Skelettierte und das Fleischige kompakt ineinander. Ikarus und Daphne. Befreites und Gefesseltes. Versuchungen und Widerstand. Und immer wieder die Erfahrung des Schmerzes: „Er hat seit je am sichersten Raison gelehrt", schreibt Max Horkheimer während des Kriegs im Winter 1941/42 (für Walter Benjamin). „Er bringt die Widerstrebenden und Schweifenden, Phantasten und Utopisten zu sich selbst, ja er reduziert sie auf den Leib, auf einen Teil des Leibs. Im Schmerz wird alles eingeebnet, jeder wird jedem gleich, Mensch und Mensch, saugt das ganze Leben des Wesens auf, das er ergriffen hat: sie sind nichts mehr als Hüllen von Schmerz. Es vollzieht sich jene Reduktion des Ichs noch einmal, von der die ganze Menschheit befallen ist"1. In allem, was August Stimpfl bewegt und was er über seine tier-und insektenartigen (mitunter wie Gottesanbeterinnen wirkenden) Frauenkörper von der „Machthaberin" und „Herrschenden" bis zur „Schmerzensreichen" und der „Pieta", von der „Gewichtigen" bis zur „Schildkrötenfrau" (schwebend im Raum in einer embryonalen „Leibhaftigkeit") komprimiert hat, in allem steckt der Schmerz — auch im Schönen, das aus ihm aufsteigt, ihn hinter sich lässt. Gaia, die Erdgöttin, und die Gottesgebärerin begegnen einander. Die Schmerzimpulse der „Schwangeren“ treten wellenförmig aus. Jede Gebärde drückt den existenziellen Konflikt aus, auch den zwischen Geist und Natur. Und den Wunsch, die (zumindest künstlerische) Lösung (Erlösung) aus diesem Konflikt zu finden in immer wieder neuen Anläufen und Umkreisungen des zum Symbol, zur Metapher werdenden weiblichen Körpers. „Alles, was vor dem Horizont liegt", bemerkt der Künstler2, „erregt die Sinne, mit deren Hilfe ich das Dahinterliegende aufzuspüren versuche." Es ist die Frage des „woher kommen wir, wohin gehen wir." Die Frage nach den Anfängen. Nach den „Akten der Menschwerdung" (Anton J. M. Isenring über den Künstler). Sie stehen im Zentrum. Aber viele gewichtige, dem Werk Stimpfl‘s immanente Komponenten begleiten diese Grundfrage: Es sind die des „Machens", des Materials, des Zusammenhangs mit verwandten Erscheinungen, des Verhältnisses Frau — Mann oder auch Mensch —Tier, des „beschädigten Lebens", von dem die Reflexionen Theodor W. Adornos in „Minima Moralia" handeln. Der weiß über den Künstler, dass er nicht sublimiere. Dass Künstler „ihre Begierde weder befriedigen noch verdrängen, sondern in sozial wünschbare Leistungen ihre Gebilde verwandeln", sei eine „psychoanalytische Illusion". „Vielmehr zeigen Künstler heftige, frei flutende und zugleich mit der Realität kollidierende, neurotisch gezeichnete Instinkte ..." Von Albert Steffen wird der Künstler als das Urbild des Menschen bezeichnet. Aber der Mensch sei Künstler gewesen, wie „der Biber es ist, der seinen Bau bildet. Er hatte ein Können, aber kein Wissen. Ebenso wenig wie die Bienen wissen, was für kosmische Geheimnisse in der Struktur der Zelle sind, die sie bauen, wusste er, nach welchen Gesetzen er schuf. Der Mensch besaß alle Fähigkeiten der Tiere als essentielles Können. Er vereinigte das Adler-, Stier- und Löwenwesen (um die drei Haupttypen zu nennen) in einheitlichem Zusammenwirken. Sie waren Teile seines Organismus. Es war das Tierreich. Es herrschte Harmonie und sie spiegelte sich im Leib des Menschen als Schönheit. Diese Schönheit war eine Gattungsschönheit, wie die der Tiere es noch heute ist"3. Jetzt ist der Künstler mehr ein Wissender (mit allen damit verbundenen Belastungen) als ein Könnender, auch wenn er etwas kann und dennoch weiß, dass „Kunst und Können" zuweilen ein ungleiches Paar sein müssen. Könnerschaft allein trägt kein Werk mehr, und häufig suchen sich Künstler ihr ganz bewusst zu entledigen, weil sie es um der Wahrheit willen tun müssen. So bewegen wir uns in einer Welt „der nicht mehr schönen Künste." Stimpfl sucht zu vermitteln, aber nicht um jeden Preis. Die Schönheit des Leiblichen am Menschen glimmt bei ihm (noch) auf. Vor allem aber das, was an ihm an Geruch und Geschmack wahrnehmbar wird. Tatsächlich glaubt man sie mitunter riechen zu können, seine Leiber — das Erdige, die Ausdünstungen der Haut, Blut, aber auch den intensiven Duft von Pflanzen und Blumen, die Frische des Wassers, schließlich auch die Fäulnis, das Muffige des Vermodernden. Jedenfalls sind seine Farben und das, was über sie aus Körpern sinnenhaft erfahrbar herauszutreten scheint, nichts Abstraktes sondern unmittelbar Aufnehmbares. Geruch und Geschmack, stellt Walter Schurian fest, seien gegenwärtig „aus dem Ästhetischen verbannt"4. Auch in der Kunst (was freilich nur bedingt zutrifft). Im Gegensatz zu den sinnlichen Reichtümern etwa der Niederländer-Malerei, die „geradezu vor Gerüchen und Geschmäcken" strotze, sei die gegenwärtige Malerei, „im psychologischen Sinn, karg und geruchsfrei". Der „organellen Ebene" werde dabei kaum noch Rechnung getragen. Schurian schrieb dies allerdings im Hinblick auf das, was „konkretisiert" und „minimalisiert" werde — und das hat sich ja in den ablaufenden achtziger Jahren wieder verändert, auch den Stimpfl‘schen Schöpfungen wieder Aktualität verliehen. Ganz abgesehen davon, dass es parallel zu allen Reduktionsversuchen immer auch die große Offenheit gegenüber dem zum Symbol erhobenen Material gegeben hat, etwa bei den Relikten des Orgien Mysterien-Theaters bei einem dionysischen Euphoriker wie Hermann Nitsch oder den „weichen" Stofflichkeiten bei Joseph Beuys (dessen Zeichnungen die eine oder andere Übereinstimmung zu Stimpfl erkennbar werden lassen könnten, und zwar nicht nur formal). An anderer Stelle verweist Schurian im übrigen — und auch in diesem Fall ergeben sich Bezugspunkte zu den Gestaltungen Stimpfl‘s und ihren Tiefen — auf die mehrschichtigen Strukturen des „Organismischen" und die „klassische Ebene des Freud‘schen Es: reiner Selbstausdruck, keine Reflexion, Ströme der Lust". (Es handelt sich dabei, das muss betont werden, um eine Seite der Stimpfl‘schen bewusst-unbewussten Ansätze für die Entwicklung seiner Körper-Komplexe). „Dies", so Schurian, „ist das Reich des Lautreamontschen ,Maldoror'. Aus dem verwechselbaren großen Ganzen", das alles mit allem verbinde und wo noch keine Individualität herrsche (die bei Stimpfl mehr oder weniger konsequent ausgelöscht erscheint, jedenfalls in seinem Bestreben, ein Grundverhalten, Grundposen auszufiltern), „erheben sich die Gebilde und die Gestalten. Aus dem Nichts ergeben sich Konturen, sie vibrieren und sinken wieder in sich zurück in das Urmeer des zellulären Ganzen." Dort erhebe die Kubinsche „andere Seite" ihr Haupt, das (bei Stimpfl stets nur im Hintergrund angedeutete) Entsetzen, das Grauen, die Nachtseiten des Ungefähren, der Schrecken . . . Lust und Grauen wohnen hier noch fast ununterscheidbar beieinander. Es ist der Nebelbereich, der Untergrund, der Schatten unserer Existenz, das Diesseits von Gut und Böse; alles jedoch schon in eine Form gebracht, informiert und konturiert. Objekte werden z. B. zu Totems, erhalten dergestalt eine veränderte Bedeutung und verweisen jeweils auf anderes." „Totem" bildet ein Stichwort für den Deutungs- oder Erklärungsversuch, die Beleuchtung des Hintergrunds der Stimpfl‘schen Körper. Er lässt aus ihnen Ur-Erfahrungen sprechen, lässt die Ur-Mutter heraustreten, ihre Verbundenheit mit den Elementen, aus denen sie hervortaucht und in die sie wieder eingeht. Bei Stimpfl stets als das Erscheinende, Gewichtige, Fassbare und sich zugleich auch Auflösende, Leichte, Verschwindende, das sich einem Kreislauf einverwoben zeigt, den der zeichnende Maler und der malende Zeichner durch das einander überlagernde, hervorkehrende und auslöschende, freimachende und verdeckende Element einerseits hervorhebt und andererseits als das Geheimnisvolle unberührt lässt. Wenn von einem Urzustand die Rede sein kann, der vor der Spaltung „zwischen Denken und Begehren, zwischen Vernunft und Sinnlichkeit, zwischen Formtrieb und Stofftrieb" geherrscht haben mag, die „Seelenfähigkeit Denken, Fühlen und Wollen noch nicht voneinander geschieden waren", Innenwelt und Außenwelt noch in eins zusammenfielen, in das, was der Mythos „das goldene Zeitalter" nennt (wie es Albert Steffen ausführt), dann taucht ein Menschenbild vor uns auf, an das wir uns bei der Betrachtung des Stimpfl‘schen Kreisens um ein- und dieselbe Figur aus Licht, Luft und Erde erinnern können. Es ist der Mensch, der sich „mit den Elementen verschmolzen" fühlte. „Er war in einer übersinnlichen Gestaltenwelt. Die kosmischen Tatsachen traten in sein Inneres nicht als Gedanken, sondern als Bilder . . . er schaute dieses Wissen in den Farben und Formen, in der Bewegung, in dem Zusammenwirken der Gestalten, die er wahrnahm. Er hörte es in Klängen und spürte es in Geschmäcken. Eine Farbe, ein Ton, ein Geschmack, die in ihm auftauchten, sagten ihm: Das ist die Wirklichkeit eines bestimmten Planeten. Er schaute ein Rot und empfand: Der Mars spielt sich aus. Er hörte einen Dreiklang und empfand: Venus, Erde und Merkur stehen in einem bestimmten Verhältnis zu-einander . . ."5. In solcherart Mythisches suchen Stimpfl‘s Gedanken einzudringen, wenn er sich mit den alten Griechen, mit Artemis und den Amazonen, mit Bachofens „Mutterrecht", aber auch mit Theresa von Avila und der Mystik auseinandersetzt, der „Frauenfrage" unter ganz anderen Aspekten, als sie gerade virulent oder opportun erscheinen, auf der Spur. Steffen spricht auch vom Bild der Eva: „Jedes Zeitalter hat ein Antlitz. Das der Eva war traumhaft schön; es wurde durch die Abirrung nach links verflacht und durch die Abirrung nach rechts verfinstert, es wurde hässlich und krank, der Tod sah hindurch" (tatsächlich stellt es sich so ähnlich auch in einigen Arbeiten Stimpfl‘s dar) . . . „Ich fragte mich", so Steffen weiter, „wie ich so auf der Straße ging, wie Eva in unserer Zeit aussieht, da begegnete mir eine Gastarbeiterin mit grüner Haut und ockergelbem Haar. Die Eva von heute verfertigt Bomben . . ." Und dann (wieder wie auf Stimpfl gemünzt): „Die alte Schönheit war die Gattungsschönheit, ohne Zutun des Menschen entstanden, das Bild der Gottheit. Die neue Schönheit ist die individuelle, durch den Willen des Menschen erreicht, das Bild der Ichheit." In ihr ist auch das Brüchige, das Kranke, das Leidvolle, das Maskierte, das Disharmonische, das Dunkle. Es ist die Schönheit der Malereien Stimpfl‘s, die dazu beiträgt, was Steffen die Gesundung nennt, die ein malerisches Problem sei: „Man rufe das Licht zu Hilfe, dann gelangen Freude, Begeisterung und Mitleid geläutert und leuchtend zum Ausdruck." Natürlich klingt all dies (von Rudolf Steiners Welt-Begriff her entwickelt) fast zu schön; zu esoterisch. Aber auf Stimpfl scheint es zumindest partiell oder einen bestimmten Aspekt seiner Aufgabenstellung zuzutreffen. Zum malerischen Problem bei diesem Künstler ein kleiner Exkurs. Es handelt sich bei ihm um den alten Streit zwischen dem Primat der Zeichnung vor der Farbe oder umgekehrt. Die Vorherrschaft des „disegno" während der Renaissance löst sich im 17. Jahrhundert weitgehend auf, an dessen Ende Roger de Piles der Farbe — sogar in Anspielung auf die Genesis — die gegenüber der Zeichnung überlegene Rolle als der eigentlich spirituellen Bildmacht und als der wahren Beseelung der Form zuschreibt6. Dabei bezieht er sich auch auf die Farbakkorde bei Rubens und unterscheidet sehr schön die „je spezifischen Ausdruckskräfte der Farben voneinander", wie sie (als Erdfarben) auch die Chromatik bei Stimpfl vorherrschend bestimmen: die Ockertöne oder das Azurblau und das Braun-Rot als eine Qualität „des plus terrestres et de plus sensibles ..." . Rubens, so Max Imdahl, habe die Vorstellung „des undurchdringlich Skulpturalen in der Malerei aufgelöst, um Figuren und Dinge in ihrer natürlichen Stofflichkeit darzustellen. Zugleich bedeutet die Auflösung des Skulpturalen eine Hinwendung auf das Erscheinungshafte, und dieses wiederum richtet sich in der umfassenden Geltung des sui generis optischen und zudem den clair-obscur einbeziehenden coloris nicht nur auf die Figuren und Dinge in ihrer Einzelheit, sondern es erschafft deren tout ensemble. Der tout ensemble aber offenbart sich als das generelle, das Bildganze bestimmende und vielfältig differenzierte Akkordische der Farbe in ihrer Buntnatur, er erfordert die Überschaubarkeit des Bildes in seiner Gesamtheit und eröffnet zugleich die Möglichkeit zu frei malerischen Abbreviaturen." Peter Weibel hat auf das Problem der nicht vorhandenen Linie bei Stimpfl, auf seine Farbkörper im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Wiener Körperästhetik hingewiesen7. Sein Versuch, Stimpfl „in eine ästhetische Richtung der neueren österreichischen Kunstgeschichte" einzureihen, und zwar in eine Geschichte, die mit Klimt, Schiele und Gerstl begonnen habe und in den sechziger und siebziger Jahren in einer Körperästhetik gemündet sei, von der man versucht sei zu sagen, sie sei eine Wiener Körperästhetik (obwohl sie natürlich durch Künstler aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und auch aus Tirol geschaffen worden ist), muss zwar relativiert und ergänzt werden. Was er aber über die Farbe als konturbildendes Element bei Stimpfl angemerkt hat, betrifft wieder den tout ensemble. „Es ist", so Weibel, „die rinnende Farbe, welche dem Körper Kontur gibt, sofern man überhaupt von Kontur sprechen kann. Das Papier nämlich knautscht sich gleichsam zusammen zu einem Körper. Der Körper ist eigentlich gar nicht anwesend, kaum sichtbar in den extremsten Ausformungen der Stimpfl‘schen Kunst, sondern die eigenen Vorstellungen des Betrachters finden sich in den Farbmorphien, in den Farbgestalten auf dem Papier wieder." Aus der abstrakten Farbe rinne der konkrete Körper zusammen. „Farbflächen, verdichten' sich zu Körperbildern." Nicht der Strich, die Linie gebe dem Körper die Form, sondern die Farbe konstituiere den Körper. Die Farbfläche gebe dem Körper keinen Umriss, sondern Volumen. Weibel interpretiert die „freigelassene Motorik der Farbe als Erfahrung der Freiheit des Körpers. Indem er dem Körper keine zeichnerische Kontur gibt, sperrt er ihn gar nicht erst ein in eine Form, sondern lässt ihn offen, löst ihn, erlöst ihn." Diese „Malereiimmanente Körperästhetik der Sättigung und Fülle" sei eine körperimmanente Körperdarstellung mit dem Ziel, „eine körperliche Empfindung vom Körper auszulösen, den Körper pur zu zeigen . . .". Und nun schildert Weibel tatsächlich eine für Stimpfl sehr wesentliche Komponente, die ihn — auch wenn er von der Qualität seiner Arbeit her durchaus mit den Wienern zwischen Lassnig und Frohner oder auch Eisler und Hrdlicka, die aber allesamt andere Ziele mit anderen Ergebnissen verfolgen, vergleichbar erscheint — von den Ansätzen der anderen trennt. Weibel meint, dass nicht der soziale und psychische sondern der irdische Körper dargestellt werde. Dem lässt sich nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass erkannt wird, wie stark die quasi „außerirdischen" Komponenten sind, die sich in Stimpfl‘s Physis erkennen lassen, und zwar durchaus so, wie Weibel das beschrieben hat: „Durch Farbritzen blicken wir tief hinab in die Geheimnisse des Körpers. Durch Farbrisse und -brüche steigen Empfindungen auf. Die Leibhaftigkeit des Leibes finden wir im Mittelpunkt der Stimpfl‘schen Körperästhetik. Damit natürlich auch Fragen des Leids und der Freude, des Todes und des Lebens. In diese irdische Körperästhetik kommt daher auch ein Schuss Metaphysik, eine Erlösungssehnsucht ..." . Ausgeprägter als die „Wiener Körperästhetik" — und das scheint Weibel übersehen zu haben — mutet jedoch eine andere Analogie an. Deutlicher drängt sich nämlich die Verwandtschaft zu Herbert Boeckls frühen Akten aus dem Jahr 1920 auf. (Stimpfl wird gewiss wie viele andere von Boeckls legendärem „Abendakt" an der Wiener Akademie beeinflusst worden sein). Es sind Kohlezeichnungen (jenes „malerischen" Typs mit Verwischungen und Auslöschungen oder Akzentuierungen, wie wir sie auch von Stimpfl kennen) mit ihren schemenhaft skizzierten Körperteilen, bei denen einzelne Partien wie „beleuchtet" hervortreten, in einer Licht-Schattenbewegung transparent gemacht. Boeckl selbst bemerkte Jahrzehnte später8, dass die Aktzeichnungen zwischen 1918 und 1920 in seinem Schaffen einen besonderen Platz eingenommen hatten: „In jener Zeit, da Schieles Zeichenkunst die ganze junge Generation in ihren Bann schlug. Durchdrungen von meinen besten Gefühlen gleichen diese Zeichnungen kleinen Bergwerken" (wieder das Vordringen in die Tiefe wie bei Stimpfl, „Bergwerke" aber auch im Sinn des Bewahrens von Schätzen, die nach und nach hervorgeholt werden), „in die ein seltener Sonnenstrahl fiel. Zwischen die geöffneten Schichten dringt das Samenkorn ...” . „Die menschliche Gestalt", bemerkte dazu Werner Hofmann9, „wird nicht physiognomisch individualisiert, sondern als all-gemeiner Typus gesehen" . . . als ein elementares, um die Kernzone kreisendes Volumen. „Der Akzent liegt auf dem Leib, das expressive Gestikulieren der Gliedmaßen kommt nicht zum Zug. Ein wesentliches Merkmal dieser Gestalten ist ihre pulsierende Offenheit. Ihre Körper sind nicht gegen den Umraum linear abgedichtet, sie nehmen ihn vielmehr in sich auf, ohne deswegen ihre Masse preiszugeben. Mitten in der Körperzone entstehen Raumbecken und Raummulden. Boeckl modelliert Raum in den Körper hinein." Sehr ähnlich — wenn auch unter anderen Voraussetzungen, mit anderen Erfahrungen und einem vergleichsweise angereicherten, über die Anlage, den Entwurf hinaus zum Bild tendierenden Ergebnis unter Einschluss „informeller" Sichtweisen (auf die auch frühe, motorische, etwa an die Vorgangsweise bei K. R. H. Sonderborg erinnernde Arbeiten hinweisen) — geht August Stimpfl vor, nachdem er auch eine zum eher Technoiden neigende Phase überschritten hatte. Das Raumbecken, das Raumvolumen wiederholt sich dort, wo die Spezifika des Frauenkörpers als Träger auch außerhalb seiner wirkenden Volumina betont werden, in Körperschluchten und „Körperknoten", die ihrerseits (wie Hofmann zu Boeckl anmerkt) „die Züge einer verletzten Landschaft" in sich tragen. Stimpfls Körperlandschaften korrespondieren im übrigen mit dem, was den Künstler außen umgibt: dem Gebirge und seinen Durchflochtenheiten, seinem Wechsel zwischen Vegetativem und Erstarrtem und dem, was sich in seine Formationen hineindenken, hineinempfinden, herauslösen und es in eine Beziehung zu dem setzen lässt, wovon seine Frauen-Paysages in ihrer Anlage charakterisiert erscheinen. Es sind Landschaften voller Sinnlichkeit und Seele, ein durchlässiges Gewebe für Gefühle, ein wohlakzentuiertes Sichkreuzen von verwischten Linienströmen, in denen sich das Spröde (bisweilen auch Konstruierte) mit dem Eleganten verbindet (das Urweib mit dem „Mannequin") — ein Feld bildend, aus dem sich Gestalten wie Pflanzen in einem Empfangen und Verschlingen, aber auch wie in einem Heraustreten und Zuneigen entwickeln — aus dem sie sozusagen aussintern. Das daraus entstehende Gewordene inspiriert den Maler stets von neuem, etwa so, wie Hans Platschek es in seinen Beobachtungen über den Weg „Vom Material zur Figur" (es ist auch der Stimpfl‘s) beschrieben hat: „Was aus den Farbschwemmen und Linien auftaucht, löst Vorstellungen aus, die insofern poetisch sind, als sie Gebilde andeuten, die nicht existieren. Bei Franz Kline etwa entstehen diese Akzente aus einer möglichen Handschrift, bei Tapies wiederum, der mit einer pastosen Materie arbeitet, ergibt sich das Gebilde aus der Summe von Rissen, Schichtungen und Kerben. Doch das, wie' ist eigentlich belanglos. Ausschlaggebend bleibt jene Dialektik von Pause und Bewegung, von Aktion und Vision, von Material und Phantasie" 10. Bei Stimpfl erfolgt ein vergleichbarer Weg „vom Material zur Figur" allerdings weniger radikal, moderierter und wenn man will „ausgeglichener", obwohl auch er weiß, wie wichtig die Dissonanz als Erzeugerin jener Spannungen ist, die darzustellen ihm ja in hohem Maß gelegen ist, um sie einer neu gewonnenen Harmonie eingliedern zu können. Seine Studien direkt vor der Natur, zu denen ihn vor allem auch Reisen angeregt haben, lassen die Nabelschnur nicht abreißen, durch die er sich von seiner geistigen Wirklichkeit her mit den „Realien" verbunden weiß. Radikalität um ihrer selbst willen anzustreben: daran kann ihm nicht gelegen sein, weil es ihm ja auch um das Offenbaren eines Einswerdens oder Einsseins mit der Natur geht, auch mit der Natur der Frau und ihrem „Fremden". Wenig in Stimpfl‘s Frauenbildern und ihrer Komplexität regt im Übrigen dazu an, sie aus dem „skopophilischen Instinkt" (der Lust, eine andere Person als erotisches Objekt anzuschauen) heraus zu betrachten oder zum Anlass für entsprechende Erörterungen über das Mann-Frau-Verhältnis (sei es nun ein gestörtes oder sozusagen intaktes) zu nehmen. Es handelt sich um Menschenbilder, in die auch der Mann eingeschrieben erkennbar wird — deutlich zuletzt in der schicksalshaften, Einswerden und gemeinsames Abstürzen, Weggehen, Entschweben, Einsinken evozierenden Folge von „Paaren" (1988). In Stimpfl‘s Bildern kann aber ein Durchflochtenwerden eines männlichen mit einem weiblichen Prinzip in der Form erkennbar werden, wie es Charles Blanc 1867 in einem „Grammaire des Arts du dessin" festgehalten hat. Die Zeichnung, sagt er dort, kennzeichne den männlichen, die Farbe den weiblichen Sexus: „Le dessin est le sexe masculin de Voll; la couleur en est le sexe feminin ..." . Es ist aber auch das Zusammenspiel des poussinistischen dessin mit dem rubinistischen coloris. Ganz sicher ist August Stimpfl aber nicht jener Frauenfeind, der — wie Edgar Degas — die Frau als Werkzeug benutzt. „Das Modell", sagt Gilbert Lascault in diesem Zusammenhang11, „ist etwas, dessen man sich bedient. Es hat ihm zufolge keine Eigenexistenz. Oder diese Existenz interessiert ihn nicht." Bei Stimpfl trifft das Gegenteil zu. Er, der Maler des Wesens der Frau, unterscheidet sich diametral vom „Maler der Tänzerinnen", als der sich Degas bezeichnet sah: „Doch versteht man nicht, dass die Tänzerin für mich bloß ein Vorwand war, schöne Stoffe und Bewegungen zu malen." Stimpfl malt darüber hinweg oder darunter durch, verhüllt, verdunkelt oft mehr, als er in Erscheinung treten lässt und gelangt dadurch ins Zentrum des Körpers als Träger bestimmter Wünsche und Begierden, von Verzweiflung und Hoffnung, des alten Lieds von der Liebe, die den Keim des Todes schon in sich birgt. Ganz gewiss interessiert es ihn wenig (weil er ja auch weniger Darsteller eines Realen sondern viel mehr psychologisch und transmittierend Vermittelnder ist), das zu sein, was Laura Mulvey etwa als den bestimmenden männlichen Blick bezeichnet, der seine Phantasie auf die weibliche Gestalt projiziere, die dementsprechend geformt werde12: „In der Frauen zugeschriebenen exhibitionistischen Rolle werden sie gleichzeitig angesehen und zur Schau gestellt, ihre Erscheinung ist auf starke visuelle und erotische Ausstrahlung zugeschnitten, man könnte sagen, sie konnotieren ,Angesehenwerden-Wollen Die Frau als Sexualobjekt ist das Leitmotiv jeder erotischen Darstellung . . . Der Blick ruht auf ihr, jedenfalls für das menschliche Verlangen, das sie bezeichnet." Natürlich handelt es sich auch bei Stimpfl um „erotische Darstellungen", denen aber nichts anderes zu unterstellen ist als sein Interesse an all dem, was sich in seinen Gedanken um sie kreuzt. Was daraus entsteht, sind Gebilde sui generis, Gleichnisse für das „Leiben" und Leben, Innen-Bilder, die ein Geheimnis mehr umschreiben als dass sie es preisgeben, sofern dies überhaupt möglich wäre. In seine Figuren eingeschrieben sind die Freude, die Lust und das Opfer, die Scheu und die Neugierde, ein Offenbarwerden und eine Form des Staunens. Das Bipolare in Stimpfl‘s einerseits entkörperlichten, andererseits verlangenden, fordernden, ausströmenden, gebenden Wesen wird ganz unverwechselbar auf dreifache Weise verdichtet: einmal durch die bereits beschriebene Dualität zwischen Umriss und dessen Auflösung oder Bestimmung durch das eigentlich Konturlose (in seinen hervorstechendsten Arbeiten); durch das Ineinander von Strich und Fleck, Festem und Verfließendem; schließlich durch das Aufeinandertreffen und Verschmelzen von Hart und Weich, analog dazu von kalten und warmen Farben in auf Graumischungen abgestimmten oder auf sie abzielenden Verbindungen. Durch sie bilden sich kennzeichnende Tiefen, die Analogien zu den figürlichen Darstellungen selbst erzeugen in ihrem Hervortreten und Zurücksinken, ihrem Aufgesaugtwerden in Teilen, während bestimmte Glieder, unterstützt durch entsprechende, expressiv ausgeformte Teile und Positionen, mitunter aggressiv hervortreten im Sitzen, Stehen, Tanzen, sich Aufrichten, Gestikulieren, ihrem aktiven Verhalten. Mitunter erinnern solche Figuren in der Art ihrer „Verarbeitung", in ihrem Einschrumpfen in den Raum, auch an Alberto Giacometti und dessen ewigen Kampf um das Erfassen des Erscheinenden. So ähnlich könnte man sich Stimpfl denkend vorstellen: „Wenn man andrerseits eine Einzelheit zergliedern wollte, zum Beispiel die Nasenspitze, war man verloren. Man hätte das ganze Leben damit verbringen können, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Die Form löste sich auf; es waren nur noch Punkte, die sich vor einer dunklen und tiefen Leere bewegten. Die Entfernung zwischen dem einen Nasenflügel und dem andern war wie die Sahara; es gab keine Grenzen, keinen festen Punkt, alles entschlüpfte"13. Vielleicht um die Übersicht zu behalten und damit ihm so wenig wie möglich entschlüpfe, er sich auch herausfordern lassen könne, wählte Stimpfl zuletzt größere Formate, ging er auch einmal ab von Kohle, Pastellkreide und Aquarell, gestalteten sich seine bisher letzten Stufen im Kreisen um ein- und dasselbe „ausgemalter", malerischer, tafelbildartiger. Das begann nach der Wiedergenesung von einem bedrohlichen Zusammenbruch nach 1984 und endete bei einer Pieta in Erinnerung an Zeiten, in denen das eigene Gewissen ausgelöscht zu werden drohte, im Gedächtnis an den Vater im Konzentrationslager. Was Stimpfl‘s Generation geprägt hat, der Verlust von Illusionen, das Umdenkenmüssen, der Neubeginn, die Orientierung an sich selbst, der Kampf gegen die Angst und das Lösen innerer Konflikte — dies alles steckt auch in seinen Bildern, und es hat ihn vor gefährlichen, vor allem in der Einsamkeit des Ateliers latent vorhandenen Abirrungen in die Manier, die Routine, das Kalkulierte bewahrt. Jetzt zählt er unter seinesgleichen zu den authentischsten Künstlern des Landes, auch weil er nichts Modisches an sich hat und — die Frau nicht ohne Ironie als Katalysator befragend — einen großen Bogen schlagen konnte von einer langen Menschenvergangenheit, ihrem Vergessenen und Wiedererinnerten, bis zum Existenzgefühl der Gegenwart, das wieder Anknüpfungspunkte sucht an das, was bleibt. Nicht nur Dichter, auch bildende Künstler stiften es. Auf seinem Beobachtungs- und Untersuchungsfeld, das über die vorgegebene Themenstellung, also das Frauen-, das Menschen-Wesen hinausreicht, sucht der Künstler ein Ganzes wiederzugewinnen, indem er kontinuierlich abtastet, was ihn dazu gelangen lassen könnte. Dieses vorgestellte Ganze wird von vielen Komponenten gespeist, für dessen Differenziertes auch Stimpfl‘s Maltechnik steht. Oder seine Farben, verstanden als eine Materie, die er vollständig zu ergreifen sucht — auch in einem theologischen Sinn, den anzudeuten nicht nur vor seinen Vanitas-Vorstellungen her sinnvoll erscheint. Pierre Teilhard de Chardin spricht im Brief an eine Freundin, den er im Oktober 1926 in Tientsin schreibt, von jenem „moralischen Verfall der Leute", der von ihr offenbar ins Gespräch gebracht worden war. Er rühre nicht daher, „dass sie die Materie ergreifen, sondern daher, dass sie sie unvollständig ergreifen, in kleinen, leicht zu fassenden Stückchen, statt sich ihr entschlossen in ihrem ganzen Reichtum, ihrem heiligen Geheimnis und ihrer unvergleichlichen Majestät zu nähern." Der Genießer missbrauche das Greifbare, weil er es in so kleine Stückchen zerbrochen habe, „dass er sich einbildet, sein Besitzer und Meister zu sein. Wenn er die Größe dessen, was er entweiht, im Ganzen zu betrachten wüsste, fiele er stattdessen in die Knie. Das Grundübel, an dem wir leiden . . . ist die Unfähigkeit, das Ganze zu sehen"14. Es sieht nicht nur so aus, es ist so, dass auch Künstler von diesem Übel befallen wurden, wenn sie nur noch das Partikel wahrnehmen. Stimpfl zählt nicht zu ihnen. Seine Bilder könnte er ohne ein allumfassendes Empfinden gar nicht malen. Und so ziehen sie uns nicht zuletzt deswegen an, weil sie unausgesprochen den Anspruch erheben, eine Einheit zu stiften —wenn auch vielleicht eine andere als die alte, verlorene. Aber auf ihrer Spur.
Anmerkungen: 1: Max Horkheimer, Vernunft und Selbsterhaltung. Frankfurt/M. 1970 2: Im Katalog der Galerie Elefant, Landeck 1980 3: Albert Steffen, Kunst als Weg zur Einweihung. Der Künstler als Therapeut. Frankfurt 1984 4: Walter Schurian, Psychologie ästhetischer Wahrnehmungen. Opladen 1986 5: Albert Steffen a. a. 0. 6: Nach Max Imdahl, Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen. München 1987 7: Peter Weibel, Wiener Körperästhetik — Der Körper trägt den Traum. In: Parnaß 2, Linz 1983 8: In „Auf-Zeichnungen". Wort und Wahrheit, Februar. Wien 1948 9: Werner Hofmann im Katalog H. Boeckl, Körper und Räume. 1915-1931. Hamburger Kunsthalle 1989 10: Hans Platschek, Vom Material zur Figur. In: Bilder als Fragezei-chen. Versuche zur modernen Malerei. München 1962 11: G. Lascault, Figurees, defigurees. Petit vocabulaire de la feminite representee, Paris 1977. Zitiert nach G. Nabakowski in: Frauen in der Kunst, Frankfurt 1980 12: L. Mulvey, Die Frau als Bild, der Mann als Träger des Bildes. In: G. Nabakowski u. a., Frauen in der Kunst. a. a. 0. 13: Aus dem berühmten Brief Giacomettis an Pierre Matisse, zit. nach dem Katalog der Kestner-Gesellschaft, Hannover 1966 14: P. Teilhard de Chardin, Briefe an Frauen. Ausgewählt und erläutert von Günther Schiwy. Freiburg 1988 }}